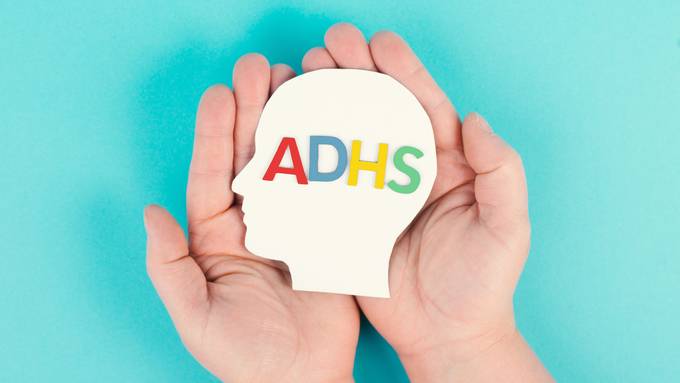ADHS: Volkskrankheit oder Tiktok-Diagnose?
Social Media erschafft Trends, keine Frage, doch mittlerweile ist Social Media gerade bei der jüngeren Bevölkerungsgruppe auch zur Informationsquelle geworden. Dies birgt Gefahren: Was, wenn sich Informationsquelle und «Trendfabrik» vermischen?
So zum Beispiel beim Thema ADHS. Viele Influencer betreiben «Aufklärungsarbeit» auf den Plattformen. Videos wie beispielsweise «11 Anzeichen für ADHS» oder «So sehen Menschen mit ADHS die Welt» haben Millionen von Klicks.
Doch helfen die Videos bei der Sensibilisierung oder schaden sie sogar und führen zu falschen Selbstdiagnosen? Stephan Kupferschmid, Chefarzt der Privatklinik Meiringen, Zentrumsleiter Psychiatriezentrum für junge Erwachsene Thun und Vorstandsmitglied der Schweizerischen Fachgesellschaft ADHS, kennt Zahlen und Fakten.
Zahlen von ADHS-Betroffenen seit 30 Jahren gleich
«Die Anzahl Menschen, die von ADHS betroffen sind, ist seit 30 Jahren stabil geblieben. Was sich jedoch geändert hat, ist die Anzahl an Abklärungen und Behandlungen», erklärt Kupferschmid. ADHS ist also kein «Social-Media-Phänomen», aber: «Social Media spielt eine zentrale Rolle für häufigere Abklärungen und entsprechende Behandlung», hält Kupferschmid fest.
Eine Sache der Sichtbarkeit
Durch Social Media wird das Thema ADHS sichtbarer und erhält mehr Aufmerksamkeit, mehr Erkrankte gebe es deswegen aber nicht. Dank Influencern und Betroffenen, die über ihre ADHS-Symptome sprechen, werden aber auch atypische Symptome bekannter.
Stigmas werden gebrochen
Allgemein helfe Social Media, die Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen zu lösen. «Es wird mehr darüber gesprochen und das ist gut so», sagt Kupferschmid. So bewegen sich beispielsweise auch Lehrkräfte auf Social Media und werden durch solche Beiträge aufmerksamer.
«Früher kannte man nur den lauten, hibbeligen Jungen als ADHS-Betroffenen. Dank diesen Beiträgen ist aber auch das ruhige, aus dem Fenster starrende Mädchen beispielsweise bekannter und Lehrkräfte können entsprechend reagieren», sagt Kupferschmid weiter.
Die negativen Seiten
Natürlich gibt es aber auch negative Seiten: «Durch Selbstdiagnosen wird vieles im Alltag heute zu rasch pathologisiert. Ein einfaches Stimmungstief wird zur Depression, ein Konflikt bei der Arbeit zu Mobbing», erläutert der Experte. Dabei kann der Blick auf die eigenen Ressourcen und Problemlösefähigkeiten verloren gehen.
Zudem werden psychologische Definitionen als einfache Begrifflichkeiten inflationär verwendet. So wird das Wort «triggern» als Synonym für genervt verwendet. Dabei stammt das Wort aus der Traumatherapie, bei dem beispielsweise ein bestimmter Geruch besonders unangenehme Gefühle oder ein traumatisches Erlebnis wieder hervorruft.
«Sprache verändert sich, das ist Teil der Realität. Problematisch wird es, wenn Personen sich auf diese Krankenrolle reduzieren», erklärt er weiter. In der Therapie versuche man nämlich genau das Gegenteil: «Man soll etwas machen trotz Diagnose und nicht wegen einer (Selbst-)Diagnose in eine Art Schonhaltung geraten. Also nicht ‹ich kann das nicht, ich habe ADHS›», sondern, «ich hab mein ADHS im Griff und kann meine Ziele erreichen», hält Kupferschmid fest.